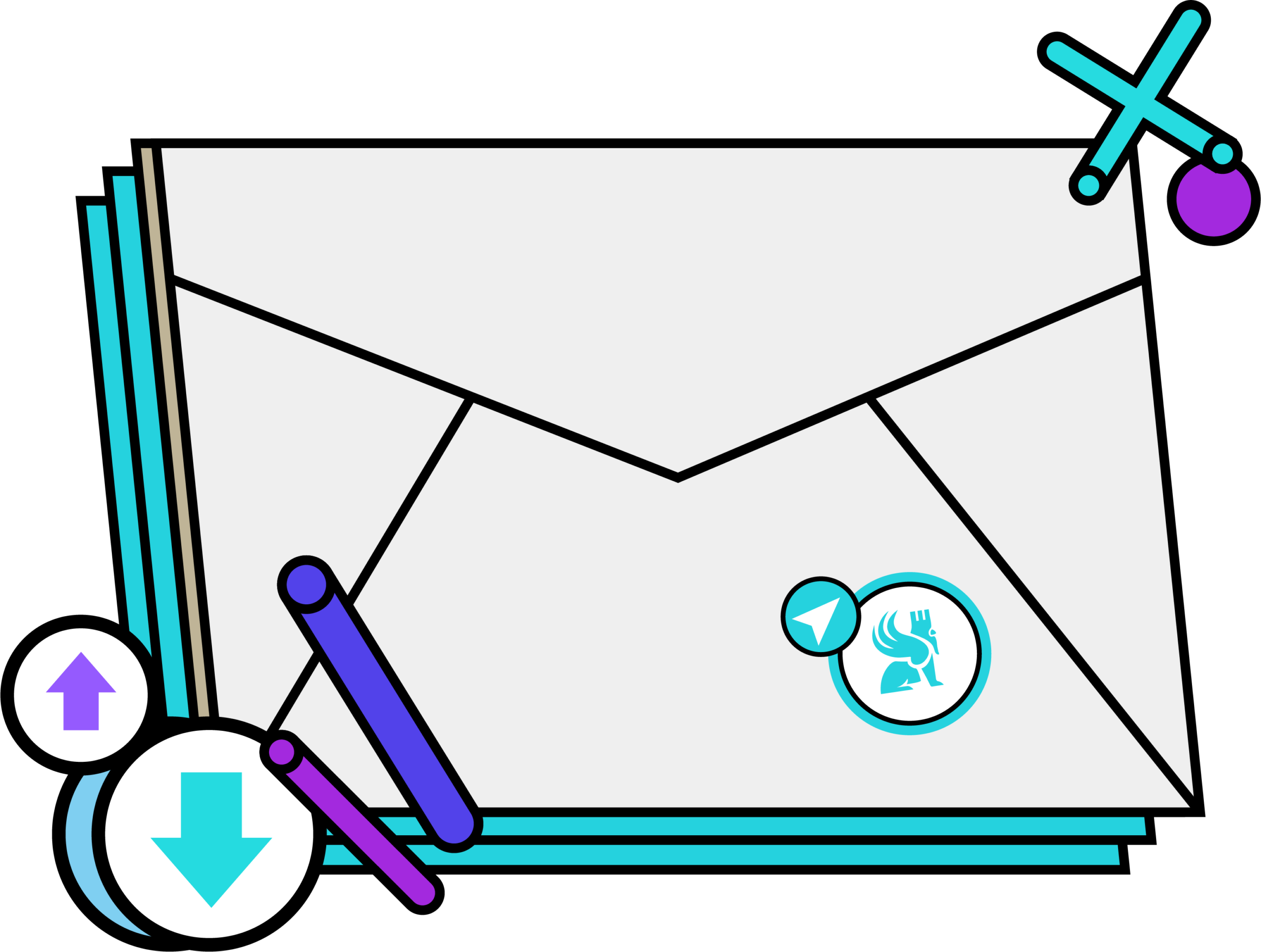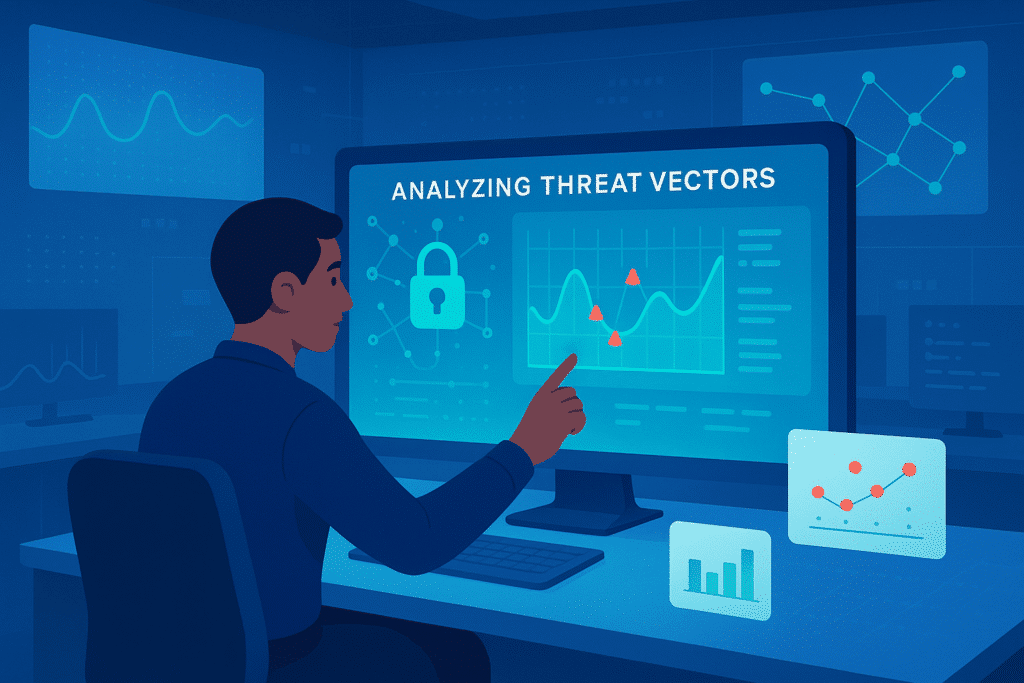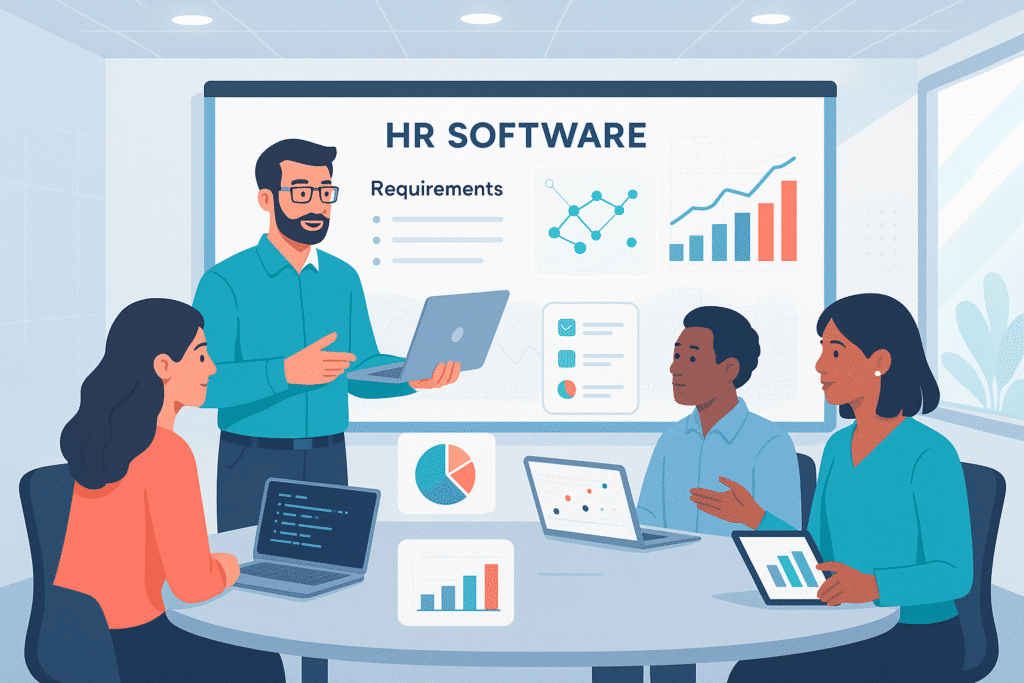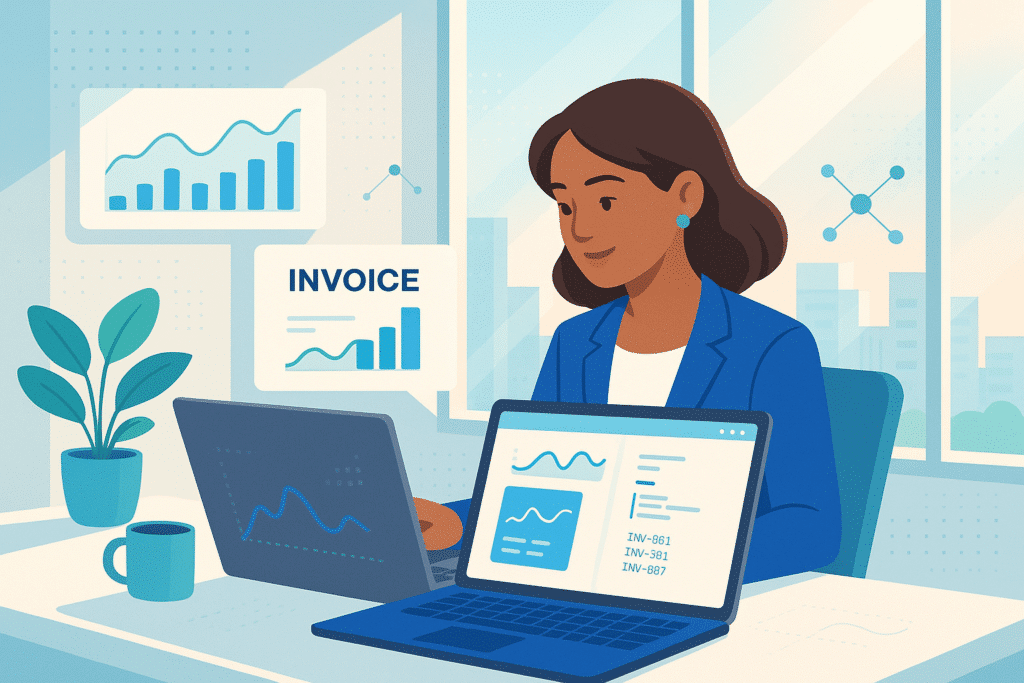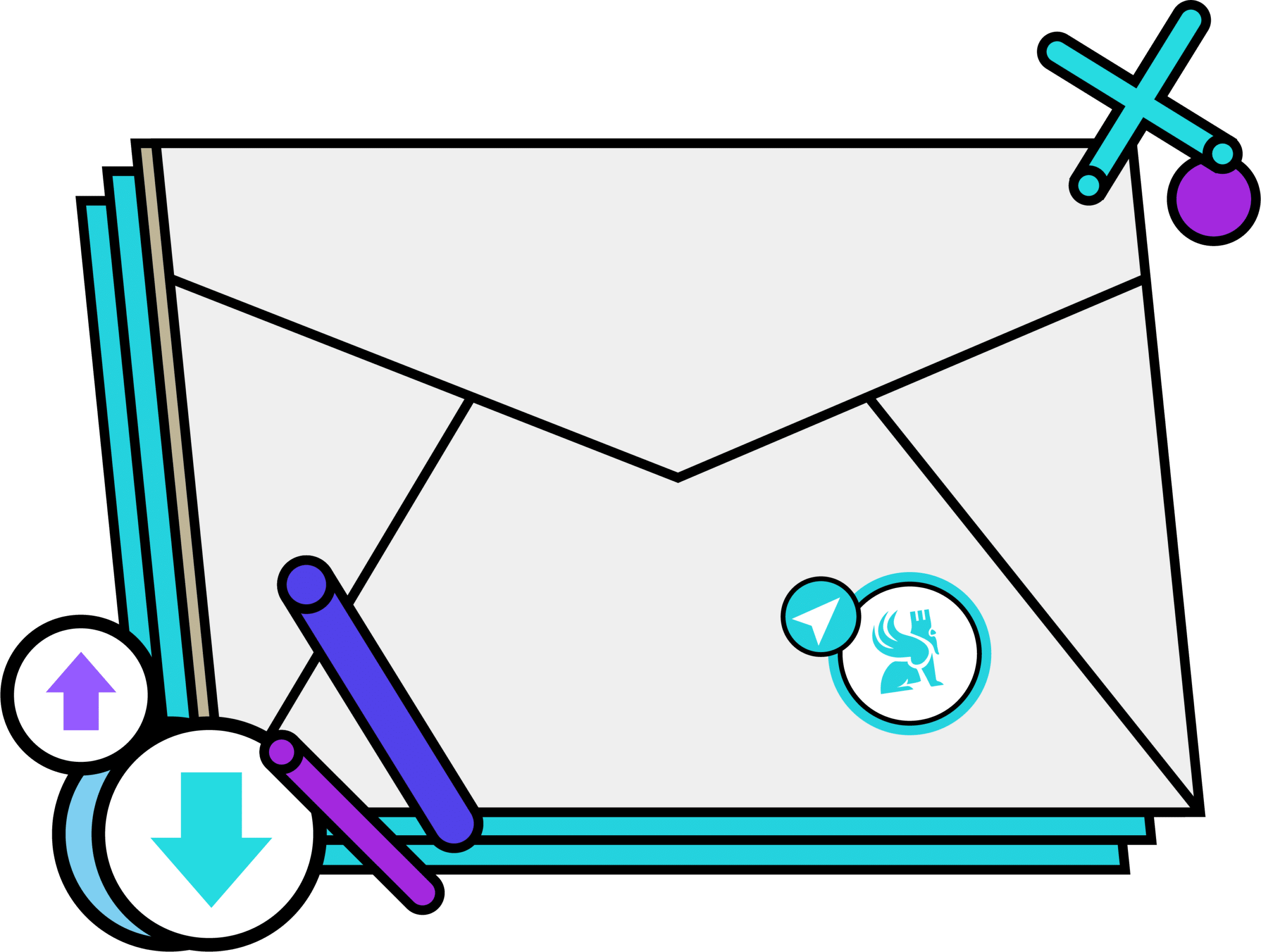Python-Annotationen bieten zusätzliche Informationen über Variablen oder Funktionen. Sie können z. B. die Lesbarkeit des Codes verbessern oder Fehler mithilfe von IDEs oder Bibliotheken von Drittanbietern aufspüren. Hier erfährst Du alles, was Du über Python-Annotationen wissen musst und wie Du lernst, sie zu verwenden.
Programmiersprachen wie C, C++ oder Java setzen auf statische Typisierung. Das bedeutet, dass Du den Datentyp einer Variablen deklarieren musst, bevor Du sie im Programm verwendest.
Python funktioniert anders. Es ist dynamisch typisiert, daher musst Du den Datentyp einer Variablen nicht vorab angeben – er wird erst zur Laufzeit bestimmt. Mit anderen Worten: Du brauchst beim Programmieren in Python den Datentyp nicht explizit festzulegen, da die Sprache ihn automatisch aus dem aktuellen Wert der Variablen ableitet.
Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. Dynamische Sprachen machen es leichter, Code schnell zu schreiben, bergen aber auch Risiken: Typfehler werden erst während der Laufzeit sichtbar. So können Probleme entstehen, die eigentlich schon in der Entwicklungsphase erkannt werden sollten. Außerdem kann das Fehlen einer Kompilierung die Performance negativ beeinflussen.
Auch unklare oder zu lange Variablennamen können den Code schwerer lesbar machen. Falsche Annahmen über das Verhalten bestimmter Funktionen oder fehlerhafte Verknüpfungen führen zusätzlich zu potenziellen Bugs.
Seit Version 3.0 bietet Python deshalb Annotationen, um genau hier anzusetzen. Mit ihnen kannst Du den Datentyp von Variablen explizit kennzeichnen. Das macht den Code nicht nur verständlicher, sondern hilft auch, Typfehler bereits vor der Laufzeit zu entdecken. So wird die Entwicklung robuster und übersichtlicher.
Was sind Python-Annotationen?
Annotationen sind eine Python-Funktion, mit der Du den Datentyp von Variablen oder Funktionsparametern klar angibst. So wird Dein Code leichter zu lesen und Fehler lassen sich schneller aufspüren.
Man unterscheidet zwei Hauptarten von Annotationen: Funktions- und Variablenannotation. Beide haben ihre eigenen Einsatzbereiche.
Funktionsannotationen geben in der Regel den Datentyp der Parameter und den Rückgabetyp einer Funktion an, können aber auch zusätzliche Beschreibungen enthalten.
Variablenannotation wurde ursprünglich in PEP 484 über Typkommentare ermöglicht, die den Datentyp einer Variablen festhalten. Diese Kommentare erwiesen sich jedoch als umständlich. Erst mit PEP 526 in Python 3.6 kam eine offizielle Syntax für Variablenannotation. Dabei gilt zum Beispiel die Regel, dass vor oder nach dem Doppelpunkt kein Leerzeichen stehen darf.
Für komplexe Datentypen wie Listen oder Tupel nutzt Du das typing-Modul. Damit kannst Du Funktions- und Typannotation kombinieren und auch verschachtelte Strukturen sauber dokumentieren.
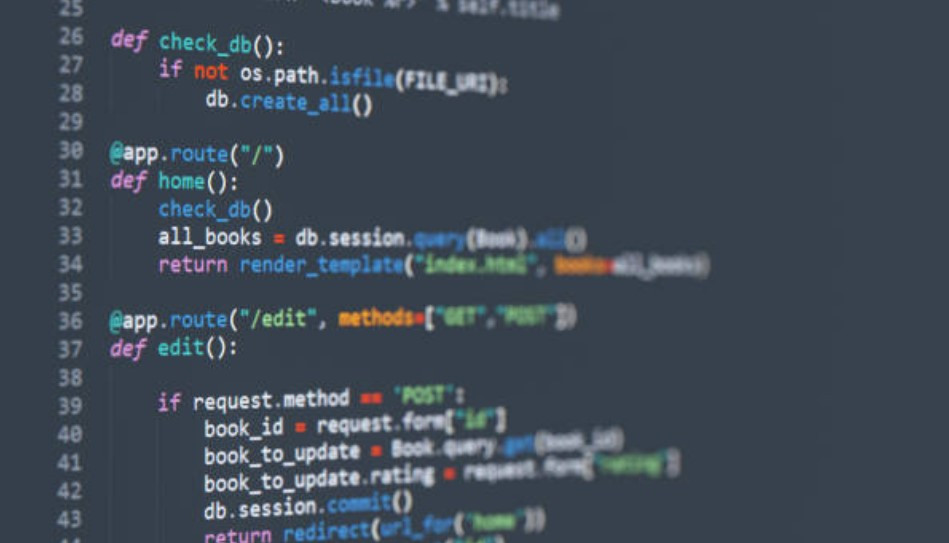
Wie greifst Du auf Python-Annotationen zu?
Um auf Annotationen zuzugreifen, verwendest Du das Attribut __annotations__ eines Funktionsobjekts. Die Ergebnisse erhältst Du als Dictionary, in dem die Parameter als Schlüssel und die zugehörigen Annotationen als Werte hinterlegt sind.
Auch wenn der Rückgabewert einer Funktion kein klassischer Parameter ist, fügt Python den Key return hinzu, um den deklarierten Rückgabetyp anzugeben. Hat eine Funktion keine Annotationen, liefert __annotations__ einfach ein leeres Dictionary zurück.
Wozu dienen Annotationen?
Annotationen haben verschiedene Einsatzbereiche. In erster Linie ermöglichen sie es, Typfehler schon vor der Laufzeit zu erkennen. Dafür nutzt Du Tools wie mypy, das von Jukka Lehtosalo entwickelt wurde, um die Vorteile statischer Typisierung in einer dynamischen Sprache wie Python bereitzustellen.
Mypy überprüft Deinen annotierten Code, meldet inkonsistente Typen, warnt bei fehlerhafter Syntax und unterstützt graduale Typisierung – Du kannst also nach und nach Typinformationen ergänzen. Vergleichbare Werkzeuge sind etwa pyright, pytypes oder pyre.
Auch moderne IDEs wie PyCharm erkennen mithilfe von Annotationen den Datentyp einer Variablen und schlagen passende Methoden vor. Das verbessert nicht nur die Autovervollständigung, sondern erleichtert auch die Fehlersuche direkt beim Schreiben des Codes.
Darüber hinaus erhöhen Annotationen deutlich die Lesbarkeit des Codes, weil Datentypen klar und explizit angegeben sind. So sparst Du Dir oft lange Docstrings oder Kommentare, um die erwarteten Datentypen zu erklären.
An sich bringen Annotationen keinen direkten funktionalen Vorteil in Python. Ihren eigentlichen Mehrwert entfalten sie erst durch Tools von Drittanbietern wie Linter, Type Checker oder IDEs, die diese Informationen gezielt auswerten.

Python lernen – so holst Du das Maximum aus der Sprache heraus
Python bietet viele raffinierte Features wie Annotationen, mit denen Du das volle Potenzial der Sprache ausschöpfen kannst. Wenn Du Python von Grund auf lernen möchtest, ist DataScientest ein idealer Einstieg.
Alle unsere Programme enthalten ein eigenes Modul zur Python-Programmierung inklusive der wichtigsten Data-Science-Bibliotheken wie NumPy und Pandas. Ergänzend vermitteln weitere Module die Themen Datenanalyse, Machine Learning, Data Visualization und Business Intelligence.
Nach Abschluss des Kurses verfügst Du über alle Kenntnisse, um den Beruf auszuüben, der zu Deinem gewählten Programm passt – ob Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer oder Data Manager. Mehr als 80 % unserer Alumni finden direkt nach dem Kurs einen passenden Job.
Unsere Weiterbildungen werden komplett online durchgeführt und kombinieren gecoachte Lernplattformen mit Live-Masterclasses. Du kannst flexibel zwischen einer berufsbegleitenden Weiterbildung und einem intensiven Bootcamp wählen – je nach Zeitbudget und Lernstil.
Auch die Finanzierung ist gesichert: Alle Programme sind für das Persönliche Lernkonto (CPF) sowie für Maßnahmen wie POEI bei Pôle Emploi für Arbeitssuchende zugelassen.
Warte nicht länger und entdecke DataScientest – so nutzt Du die Stärken von Python und startest Deine Karriere im datengetriebenen Umfeld.
Jetzt kennst Du die wichtigsten Aspekte der Python-Annotationen. Mehr spannende Details findest Du außerdem in unserem Python-Dossier und im IDE-Dossier.